Presse & Kommunikation
| EINBLICKE NR.22 | OKTOBER 1995 |
|
FORSCHUNGSMAGAZIN DER CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT OLDENBURG
|
|
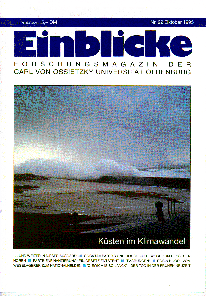
Inhalt
- Küsten im Klimawandel
- Parteienfinanzierung: Ein Gesetz entsteht
- Cocktailpartys und Hörgeräte: Wege zum besseren Hören
- "Paarungen"
- Robin Hood - Vom Wegelagerer zum Nationalhelden
- "O ewich is so lang" - Der Tod in der Frühen Neuzeit
- Nachrichten der Universitätsgesellschaft
- Notizen aus der Universität
- Promotionen und Habilitationen 1994
- Summaries
"O ewich is so lanck"
Der Tod in der Frühen Neuzeit
von Heike Düselder und Heinrich SchmidtTod und Sterben bilden in unserer Zeit Bereiche, die weitgehend durch Verdrängung und Tabuisierung bestimmt sind. Der Umgang mit dem Tod ist Professionellen - Ärzten, Krankenhäusern, Bestattungsinstituten - überantwortet, und erst seit jüngster Zeit wird versucht, der Isolation von Sterbenden und der sozialen Ausgrenzung des Todes entgegenzutreten und wieder ein humanes Sterben in das Blickfeld zu nehmen. Graust es uns heute vor einem langen, qualvollen Sterben, so war es in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft gerade die Angst vor einem plötzlichen Ende - und dem, was danach folgte - die den Umgang mit dem Tod bestimmte. Die hohe Sterblichkeit, durch Epidemien oder Naturkatastrophen ausgelöste Mortalitätskrisen, gaben dem Tod seinen Platz im Leben der Menschen. Die Glaubens- und Vorstellungswelt einer noch tiefgreifend von Kirche und Religiosität geprägten Gesellschaft beeinflußte hingegen die Bewältigung des Todes. Gedruckte evangelische Leichenpredigten, die aus der Frühen Neuzeit überliefert sind, belegen, wie sehr Leben und Sterben einen Zusammenhang bildeten, vermitteln indes auch einen Eindruck des sich im 18. Jahrhundert abzeichnenden Wandels in der Einstellung zum Tod.
"Oewich is so lanck!" Also stehet fürm Gottesacker zu Oldenburg mit güldenen Buchstaben geschrieben, den Ungläubigen und Gottlosen zum Schrecken wegen der ewigen Höllenqual / welche sie wird treffen / den Gläubigen und Gottesfürchtigen zum Trost wegen der ewigen Erquickung / welche sie werden erlangen." Mit diesen Worten, die der Golzwardener Pfarrer Hinrich Gerken im Februar 1639 bei der Beerdigung des Amtmannes Caspar Heigen in dessen Leichenpredigt sprach, vermittelte er den Hinterbliebenen und der übrigen Trauergemeinde nicht nur den kirchlichen Trost und die Gewißheit, daß der Verstorbene, der ein 'sanftes und seliges' Sterben erlebt hatte, zu den Letzteren gehören würde. Der Bezug auf die spätmittelalterliche Inschrift am Tor des Oldenburger Gertrudenfriedhofes zeigt eine Einstellung zum Tod, in der die mittelalterliche Vorstellungswelt - die Furcht vor dem Jüngsten Gericht und der Gedanke an das Jenseits - noch überaus präsent und mächtig ist. Daneben aber läßt die nachreformatorische Sicht des Pastors Gerken eine stärkere Diesseitsorientierung zum Tragen kommen: Die evangelischen Leichenpredigten sollten der Gemeinde die Bedeutung eines christlichen Lebenswandels vor Augen führen und ihren Mitgliedern durch die Vermittlung christlicher Orientierungen und Verhaltensmuster die Bewältigung ihrer irdischen Probleme durch den Glauben erleichtern.
Tod und Sterben waren in der Frühen Neuzeit den meisten Menschen eine unmittelbare Alltagserfahrung. Eine generell hohe Sterblichkeit, große, manchmal extreme Schwankungen und die breite Streuung des Sterbealters bedeuteten eine wenig prognostizierbare, eben "unsichere" Lebenzeit (A. Imhof). Der Tod war ein Ereignis, das nicht nur ein individuelles, privates Problem darstellte, sondern eine öffentliche Angelegenheit, eingebettet in die Religiosität und den Glauben. Kirche und Frömmigkeit durchdrangen zur Zeit des Pfarrers Gerken das private Leben der Menschen und nahezu alle Bereiche des sozialen Lebens, und die Autorität der Kirche wirkte insbesondere durch ihre seelsorgerischen Aufgaben bis in den mentalen Bereich hinein ebenso normgebend wie disziplinierend.
Nur ein gutes Jahrhundert später scheint sich ein Wandel abzuzeichnen: Auf die "Barockfrömmigkeit" folgte mit dem 18. Jahrhundert eine Epoche, die vor dem Hintergrund der literarischen und philosophischen Strömungen der Zeit das Ende der Einheit von Kirche und Gesellschaft einleitete und auch einen Wendepunkt in der Haltung der Menschen zum Tod bedeutete. Die christliche Todesbetrachtung begann langsam und allmählich ihren Absolutheitsanspruch einzubüßen, Tod und Sterben als ehemals zentrale Lebens- und Erfahrungsbereiche rückten in eine Distanz, Verdrängung und Tabuisierung begannen sich bemerkbar zu machen.
Quellen zur Geschichte des Todes
Diesem Wandel in der Haltung zum Sterben und zum Tod im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts nachzugehen, hat sich ein regionalgeschichtliches Forschungsprojekt über den "Tod in Oldenburg" zur Aufgabe gemacht. Die Quellen, die zur Gestaltung eines solcherart mentalitätsgeschichtlich ausgerichteten Forschungszusammenhangs zur Verfügung stehen, sind vielfältig: Eintragungen in Kirchenbüchern, Sterbe- und Begräbnisregister eröffnen einen ersten Zugang, und die zahlreichen Hinweise auf Seuchen und Epidemien, auf die verheerenden Sturmfluten, die die Bevölkerung ganzer Kirchspiele dahinrafften, auf die in manchen Gebieten noch bis ins 19. Jahrhundert erschreckend hohe Kinder- und Säuglingssterblichkeit, belegen auf eindrucksvolle Weise, wie sehr der Tod seinen Platz im Leben der frühneuzeitlichen Gesellschaft einnahm und wie wenig Distanz möglich war. Der Tod und die Bedrohung des Lebens standen im Zentrum einer das gesamte soziale Leben prägenden Grundstimmung und hatten nicht selten - so hat es jedenfalls die Historische Demographie für einzelne Regionen Oldenburgs gezeigt - auch eine "skeptische Haltung" (W. Norden) gegenüber dem Leben zur Folge.Testamente und Grabinschriften, der Gang über einen Friedhof mit Grabmalen aus dem 16., 17. oder 18. Jahrhundert, überhaupt die verschiedenen Erscheinungsformen regionaler Sepulchralkultur, geben Aufschluß über die Vorbereitung auf und den Umgang mit dem Tod. Die zahlreichen Verordnungen, die in Oldenburg im 17. und 18. Jahrhundert zum Bestattungswesen erlassen wurden, sind aufschlußreiche Quellen für eine sozialgeschichtliche Studie über die Bewältigung von Sterben und Tod in einer bestimmten historischen Lebenswelt. Wie diese Lebenswelt von ihren Mitgliedern wahrgenommen wurde und mehr oder weniger deutlich gewußte Wirklichkeit war, wie sich die Menschen verhielten und durch ihr Handeln die Realität gestalteten, darüber gibt eine Quellengruppe Auskunft, die durch ihre Vielseitigkeit und ihre Eigengesetzlichkeit zu den interessantesten frühneuzeitlichen Quellen gehört: die gedruckten evangelischen Leichenpredigten und Trauerschriften des 16., 17. und frühen 18. Jahrhunderts.
Leben und Sterben im Spiegel von Leichenpredigten
Leichenpredigten aus der Frühen Neuzeit sind in nahezu jeder Bibliothek mit Altbeständen in großer Anzahl überliefert, so auch in der Landesbibliothek Oldenburg. Leichenpredigten drucken zu lassen, sie den Hinterbliebenen und der Trauergemeinde zu übergeben, sie aufzubewahren oder sogar zu sammeln, war eine Zeitströmung, deren Anfänge in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts liegen. Die ersten gedruckten Leichenpredigten sind von Martin Luther verfaßt worden (1532), der die Intention der christlichen Leichenpredigt vor allem in der Tröstung der Hinterbliebenen und der Erbauung und Belehrung der Gemeinde sehen wollte. Etwa seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts enthalten die Predigten auch biographische Angaben zu den Verstorbenen, und diese 'Personalia' werden seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts schließlich zu eigenständigen Bestandteilen der Leichenpredigt, die im Anschluß an die eigentliche Predigt verlesen wurden. Ausführliche Schilderungen des Sterbens, angefangen bei den Krankheiten oder Unglücksfällen, die schließlich zum Tod führten, bis hin zum detaillierten Protokoll der letzten Tage, Stunden, Minuten und schließlich das Verhalten des Sterbenden im Augenblick des Todes, bilden in den Leichenpredigten des 17. Jahrhunderts ein zentrales Motiv. Die Darstellung des christlichen Lebens und Sterbens, der Bewältigung von individuellen Schicksalsschlägen, schließlich der Bereitschaft eines Menschen, den Tod zu akzeptieren, sollten auf die Zuhörer und späteren Leser der Leichenpredigt erbaulich wirken, und nicht von ungefähr wurden die Erbauungsbücher des 17. Jahrhunderts später als "die alten Tröster" bezeichnet. Das Ende dieser Literaturgattung fällt etwa in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, und zu diesem Zeitpunkt haben die Leichenpredigten sowohl in ihren inhaltlichen Aussagen als auch in der äußeren Gestaltung bereits einen spürbaren Wandel erfahren, der auch auf eine veränderte Einstellung zum Tod hindeutet.Der überlieferte Bestand an Oldenburger Leichenpredigten ist von vergleichsweise bescheidener Natur, zumindest im Hinblick auf die Anzahl der Druckwerke. Die Landesbibliothek Oldenburg ist im Besitz einer Sammlung mit Personalschriften, darunter zahlreiche Leichenpredigten, aus dem Nachlaß des Bardenflether Pastoren Johann Samuel Neumann. Einzelne 'Oldenburger' Leichenpredigten finden sich in den niedersächsischen Bibliotheken und Archiven. Bei allen Vorbehalten gegenüber Schätzungen zur Gesamtzahl der überlieferten Oldenburger Leichenpredigten - schließlich sind diejenigen Bestände und Einzelexemplare, die sich in privaten, nicht katalogisierten Sammlungen, Nachlässen oder in einzelnen Pfarrarchiven erhalten haben, nur schwer bzw. überhaupt nicht zu erfassen - ergab die Sichtung und Erfassung der 'bekannten' Bestände einschließlich der Dubletten eine Gesamtzahl von gut 400 überlieferten, zum großen Teil katalogisierten Leichenpredigten und Trauerschriften auf Personen, die in der Region des ehemaligen Landes Oldenburg gestorben sind.
Der Druck einer gehaltenen Leichenpredigt war eine mit erheblichem finanziellen Aufwand verbundene Angelegenheit und blieb somit einer sozialen Ober- und Mittelschicht vorbehalten: Mitgliedern des Adels und Angehörigen eines zumeist akademisch gebildeten Bürgertums. Beamte, Pastoren - und deren Frauen oder auch Kinder - sind überproportional vertreten, und ein Blick auf die verwandtschaftlichen Zusammenhänge der Verstorbenen legt die Vermutung nahe, daß der Brauch, Leichenpredigten drucken zu lassen, eine "Modeerscheinung" wurde, die sich auf ganz bestimmte Oldenburger Familien konzentrierte. In der bäuerlichen Lebenswelt etwa spielten gedruckte Leichenpredigten kaum eine Rolle. Die Gründe für dieses scheinbar mangelnde Interesse sind - aber dies ist eine noch offene Forschungsfrage - möglicherweise im Bildungsstand, in den Kosten und auch in der geringeren Mobilität der bäuerlichen Bevölkerung zu suchen. Die in den Lebensläufen von Angehörigen des Adels oder Bürgertums häufig genannten Reisen, 'Außenverbindungen', d.h. Bekanntschaften, Kenntnisse anderer Städte, Regionen, Bräuche und schließlich auch "Moden" haben gewiß diese Art von öffentlicher Selbstdarstellung in Form einer gedruckten Leichenpredigt gefördert oder sogar provoziert.
"Ein seliges Sterbstündlein ... ohne die geringste Zückung oder Ungeberde"
Die das späte Mittelalter prägenden Idealvorstellungen des "guten Todes" wirkten noch lange in die Frühe Neuzeit hinein. Die Leichenpredigten spiegeln einen idealtypischen Verlauf des Sterbens, ein Grundmuster zur Bewältigung dieses so schwierigen Lebensbereiches wider. Sie lassen damit auch eine Methode im Umgang mit der Angst vor dem Tod erkennen, denn, so mahnt eine Leichenpredigt noch 1737, "unser Leben würde in vielen Stücken nicht so unruhig / und das Ende oftmals nicht so schrecklich seyn, wann man sich bey zeiten auf die Art beschäftigte, und sterben lernete, ehe man stirbt."Dem Ausbruch einer Krankheit als einer konkreten Lebensbedrohung wurde zunächst mit Heilungsversuchen durch Hausmittel, Medikamente oder mit Hilfe von Ärzten begegnet. Doch sobald die Krankheit als Anzeichen des bevorstehenden Todes begriffen und akzeptiert wurde, begann man - und zwar völlig unabhängig vom Alter - mit der Vorbereitung auf den Tod. Die Abwendung von allen irdischen Dingen, die "Ordnung der letzten Dinge", ist dafür eine unmittelbare Voraussetzung. Die Anwesenheit der Angehörigen, des Pfarrers, das Beten und Singen, erbauliche Lektüre und Gespräche sollten dem Sterbenden helfen, seine Schmerzen und Ängste mit Geduld zu ertragen. Beichte, Absolution und Abendmahl, der Abschied von Familie, Freunden, dem Gesinde bildeten den Abschluß des irdischen Lebens, und das Sterben selbst galt als ideal, wenn es "ohn einige schmertzliche empfindung", also ohne äußere Anzeichen von Schmerzen, Angst oder Unruhe erfolgte. Über Fragen und Antworten, über das durch Gestik und Mimik definierte körperliche Verhalten des Sterbenden wurde versucht, seinen rechten Glauben zu beweisen. Die Absicht der Leichenpredigten, der Gemeinde ein Exempel christlichen Lebens und Sterbens vor Augen zu führen, schloß nicht aus, daß das tatsächliche Geschehen im Sterbezimmer geschildert wurde, auch wenn es dem gezeichneten Idealbild offenkundig widersprach.
Sterben und Tod waren noch völlig unabhängig vom Lebensalter, das Spektrum von Todesursachen durch Krankheiten außerordentlich breit. Gleichwohl zeigen die Leichenpredigten Differenzierungen im Umgang mit dem Tod von Kindern, jungen Frauen, die im Kindbett starben, und einem alten Menschen, dem ein Pastor "ein ziemlich gesundes Alter von 75 Jahren" attestieren konnte. Individualität tritt trotz der häufig verwendeten Topoi und Stereotypen in den Personalia immer wieder hervor, und der spezifisch sozial- und mentalitätsgeschichtliche Aussagewert der Leichenpredigten liegt vor allem darin begründet, daß sie nicht isolierte Einzelheiten, sondern einen im Verständnis der damaligen Zeit sinnvollen Lebenszusammenhang mitteilen. Als 1639 in Burhave eine Frau im Kindbett stirbt, erwähnt der Pastor in der Leichenpredigt auch ihren ernsten, zu Schwermut neigenden Charakter und ihr Verlangen nach dem Sterben, das ihn seltsam anmutet: "Und unangesehen ich und die ihrige ihr mit freundlichen worten zugesprochen / sie solte doch ihren lieben Mann und kleine Kindelein bedencken / und nicht so sehr aus dieser Welt eylen / sondern vielmehr ihren willen in Gottes willen ergeben: Ist doch sterben / sterben / ihr erste und letzte Wort gewesen."
Die wenigen überlieferten Leichenpredigten, die auf Kinder verfaßt wurden - und in diesem Zusammenhang sei nochmals auf die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit, von der nahezu jede Familie in mehr oder weniger drastischer Weise auch betroffen war, verwiesen - unterscheiden sich von den Predigten auf die im Erwachsenenalter Verstorbenen und belegen deutlich die didaktische Absicht der Pfarrer, gerade hier Bewältigungshilfen entgegenzusetzen. In den Predigten finden sich zahlreiche Hinweise zur Trauer beim Tod eines Kindes, die der bislang in der Forschungsliteratur noch immer verbreiteten These von der Emotionslosigkeit in der frühneuzeitlichen Familie deutlich widersprechen. 1650 berichtet der Pfarrer in seiner Leichenpredigt für Susanna Elisabeth Dorerus, die siebenjährig am Tormin gestorben ist, das Kind habe "viel und offt mit lachendem Mündelein sich so freundlich erwiesen / also daß die itzt betrübte Eltern grosse Frewde daher empfunden und es desto lieber behalten hetten." Die "anwesenden und umbstehenden" hätten sich schließlich darüber gewundert "das ein solch kleines Kind / so viel Schmertzen und Hertzens=Angst / daß ihm offtmahls der kalte Schweiß über sein Angesichtlein geflossen / so lange ertragen und ausstehen können." Am Ende jedoch, so betonen die Leichenpredigten ausnahmslos, ist mit einem seligen, und das heißt christlichen Leben und Sterben, die Gewißheit der Auferstehung und des ewigen Lebens verbunden.
Auf der anderen Seite freilich hatte ein unchristlicher Lebenswandel - und folgt man den Eintragungen der Pastoren in den Kirchenbüchern, ihren Klagen über mangelnden Kirchenbesuch, die geringe Teilnahme am Abendmahl, so entsteht zuweilen der Eindruck, daß dies eher die Regel als die Ausnahme war - in den meisten Fällen auch eine Bestattung ohne "christgebührliche ceremonien", ohne Leichenpredigt, sang- und klanglos in aller Stille und am Rande des Friedhofs zur Folge. Säkularisierung und Privatisierung von Tod und Sterben
Wirkten die gedruckten Leichenpredigten des 17. Jahrhunderts noch primär als Instrument der Kirche, einen christlichen Habitus zu prägen, sind Zeichen eines - eher unauffälligen - Wandels etwa seit Beginn des 18. Jahrhunderts zu erkennen. Sterben und Tod entzogen sich mehr und mehr dem Zugriff der Kirche, ein Prozeß der Säkularisierung machte sich bemerkbar, der am Ende diesen Bereich zu einer privaten Sache werden ließ. Die Oldenburgische Kirchenordnung forderte 1725 die Pastoren auf, bei Beerdigungen "die Zuhörer mit allem Fleiß zu ermahnen, daß sie gerne zu Leichen mitgehen" - ein Indiz für die rückläufige Zahl der Teilnehmer an Beerdigungen. Die Lebensläufe von Verstorbenen, so die Kirchenordnung weiter, seien "ohne Weitläuftigkeit und vergeblichen Ruhm abzufassen", und auch dies ist ein Hinweis auf die Überbetonung des Weltlichen, zu der sich offensichtlich einzelne Pastoren in den Leichenpredigten verleiten ließen. Die mittelalterlich-frühneuzeitliche Kontinuität der Konzentration auf die Sterbestunde scheint beendet, das Problem der Todesbewältigung steht nicht mehr im Mittelpunkt der Leichenpredigt, die Schilderungen des Sterbens werden kürzer, verschwinden völlig aus den 'Personalia' oder aber geraten zu Inszenierungen von Frömmigkeit, wie es der selbstverfaßte Lebenslauf der im Alter von 45 Jahren verstorbenen Anna Catharina von Halem nahelegt. Herkunft, Bildung und Ausbildung, Beruf und Karriere, das Leben also, finden ihren Niederschlag in der Leichenpredigt nun in sehr viel stärkerem Maße als der Tod. Abdankungen - Parentationen-, Standreden von Verwandten oder Freunden am Grab gehalten, entwickeln sich zu einer eigenständigen Gattung, deren Druck nicht selten den der kirchlichen Leichenpredigt ersetzt. Am deutlichsten tritt der Wandel denn auch im Niedergang der gedruckten Leichenpredigten zutage. Der Einfluß der Aufklärung erfaßte die gesellschaftlichen Wertorientierungen und Denkweisen, der Tod im allgemeinen und dessen rationale Bewältigung wurden zum Thema. Die Leichenpredigten zeigen sich immer häufiger angereichert mit "einer Menge Zeugnissen, welche aus der Schrift und anderen Büchern, zum Zierrath der Reden, in häuffigen Noten pflegen angeführet zu werden", und ein orthodoxer Pastor aus Tossens erbittert sich 1741 über diese "Charletanerie der Gelehrten".
Ungefähr zeitgleich mit dem Ende der gedruckten Leichenpredigten kamen in Oldenburg private Todesanzeigen auf, die zunächst in den "Oldenburgischen Wöchentlichen Anzeigen" veröffentlicht wurden und deren Klientel zunächst die gleichen sozialen Gruppen - das Bildungsbürgertum - bildeten wie ein Jahrhundert zuvor diejenige der gedruckten Leichenpredigten.
Spürbarer noch machte sich die Säkularisierung im Bestattungswesen bemerkbar: Hygienische bzw. seuchenpolizeiliche Gründe waren es, die die Stadt Oldenburg 1791 bewogen, die Begräbnisstätte, die sich rund um die Lambertikirche erstreckt hatte, auf den außerhalb der Stadtgrenze liegenden Gertrudenfriedhof zu verlegen. Die Begräbnisplätze wurden von der Kirche getrennt, in angemessener Entfernung und mit Mauern umgeben außerhalb der Ortschaften angelegt, und damit schuf man nicht nur eine räumliche Distanz zum Tod und zu den Toten. Auf dem Lande hingegen scheint - auch in Ermangelung entsprechender obrigkeitlicher Verordnungen - dieses Ausgrenzungsbedürfnis nicht annähernd so akut gewesen zu sein, denn hier ist bis in die Gegenwart hinein die Mehrzahl der Friedhöfe nach wie vor in unmittelbarer Umgebung der Kirche als Ortsmittelpunkt zu finden.